Die Schokolade der Zukunft macht nicht dick - selbst der Verzehr von mehreren Tafeln täglich geht ohne Gewichtszunahme der Konsumenten einher. Was heute nach Science-Fiction klingt, ist ein reales Szenario - und wird in Laboren unter Ausschluss der Öffentlichkeit entwickelt.
Tatsächlich ist die kalorienfreie Schokolade mit vollem Schoki-Geschmack nur eine Kreation der Nanofood-Branche. Weltweit mehr als 600 Lebensmittel zählen mittlerweile zum Repertoire einer Industrie, für die es weder gesetzliche Bestimmungen, noch Kontrollmöglichkeiten gibt - und die für den Menschen teils lebensbedrohliche Risiken birgt. Hinzu kommen bis zu 500 Lebensmittelverpackungen, die aus Nanobeschichtungen und -materialien bestehen.
Tatsächlich kommen die Substanzen in immer mehr Bereichen der Lebensmittelbranche vor - auch dort, wo wir sie gar nicht erwarten. So sollen sie in Erfrischungsgetränken, Chips oder Schokolade den Vitamingehalt erhöhen - ein beliebter Trick, um den Konsumenten den vermeintlich gesundheitsfördernden Nutzen der Produkte zu suggerieren.
In Gemüsebrühe, Kochsalz, Gewürzmischungen und Puderzucker wird Nano-Siliziumdioxid als Rieselhilfe eingesetzt. Selbst in Fleisch und Backwaren fanden Wissenschaftler Nanopartikel - in Form von Kapseln mit Vitamin A und E oder Omega-3-Fettsäuren.
Die Winzlinge erweisen sich als nahezu unerschöpfliches Reservoire - und als ultimative Gelddruckmaschine zudem.
Dabei sind die Risiken enorm - eine wirksame Deklarationpflicht gibt es nicht.
Forscher am Universitätshospital Zürich haben mit Wissenschaftlern der Schweizer Anstalt für Materialforschung (EMPA) bereits im Jahr 2010 nachgewiesen, dass Nanopartikel die Plazenta des Menschen durchdringen und auf diese Weise die Ungeborenen erreichen.
Auf kritische Berichte über die gesundheitsschädigende Wirkung von Nanopartikeln reagierten Lebensmittelhersteller noch vor wenigen Jahren harsch: Selbst große öffentlich-rechtliche Sender, die auf Nanofood aufmerksam machten, sahen sich mit Klagedrohungen konfrontiert. Doch seit der viel beachteten Schweizer Studie dürften die Drohgebärden der Vergangenheit angehören.
Die Studie belegt: Der Transport von Nanoteilchen im menschlichen Körper erfolgt nahezu ungebremst, und macht auch vor der Plazenta der werdenden Mutter nicht halt. Die im Fachblatt Environmental Health Perspectives veröffentlichte Studie zeigte damit in aller Deutlichkeit, wie sehr ungeborenes Leben durch die Nanotechnologie bedroht werden kann: Die Partikel dringen ungehindert in den Blutkreislauf der Ungeborenen.
Frauenärzte müssen womöglich umdenken und Patientinnen auf Nanoteilchen in Lebensmitteln aufmerksam machen. Den Druck der Lebensmittelindustrie brauchen Ärzte dabei kaum zu fürchten, im Gegenteil. Die rein medizinische Herangehensweise an die Nanofood-Problematik dürfte die Hersteller ohne Gesichtsverlust zum Umdenken bewegen. Denn einen massiven medizinischen Vorwurf kann die Lebensmittelindustrie nach wie vor nicht ausräumen: Klinische Studien nach den hohen Standards der Arzneimittelzulassungen (Phase I - III) gibt es für Nanoprodukte nicht.
Krebsrisiko: Nanomaterialien außer Kontrolle
Weil es keine klinischen Studien nach dem Muster der Pharmaindustrie gibt, weisen Nanofood-Hersteller immer wieder auf Laborversuche hin, die eine Unbedenklichkeit ihrer Produkte belegen sollen. Doch solche Daten, die lediglich im „Reagenzglas" gewonnen werden, sind praktisch wertlos. Denn sichere Aussagen über die krebserzeugende Wirkung von Nanomaterialien beim Menschen lassen sich anhand von Reagenzglasversuchen nicht treffen.
Zu diesem Ergebnis kam der Forschungsbericht „Bedeutung von In-vitro-Methoden zur Beurteilung der chronischen Toxizität und Karzinogenität von Nanomaterialien, Feinstäuben und Fasern", den die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) im Jahr 2011 veröffentlichte.
Bittere Erkenntnis des Berichts war die Tatsache, dass „sich über alle Studien und Stäube hinweg keine klare Korrelation zwischen der Wahrscheinlichkeit positiver Befunde der In-vitro-Versuche und den Befunden aus Langzeit-Tierversuchen und epidemiologischen Befunden finden lässt". Vereinfacht ausgedrückt: Laborergebnisse können keine Entwarnung geben, wenn man Aussagen zur Toxizität von Nanomaterialien machen will.
Tatsächlich hatte die Auswertung von 179 Datensätzen „eher einen statistischen Zusammenhang mit der Art des Auftraggebers oder Labors (öffentlich oder privat) als mit chemisch-physikalischen Partikeleigenschaften" gezeigt, wie die Bundesanstalt mitteilte. Der Autor des Berichtes plädierte sogar dafür, „dass es angesichts der Datenlage und der Schwere einer Krebserkrankung verantwortungsbewusst sei, die vorliegenden Effektbefunde bei Ratten und bei historischen Expositionen in der Epidemiologie zum Maßstab des Handelns auch bei niedrigeren Expositionshöhen zu machen". Womit er sagte: Selbst Grenzwerte bieten keine Sicherheit.
Nur einige Jahre zuvor hatten Ärzte aus China belegt, was hierzulande zunächst so gut wie niemand registrierte. Pekinger Medizinern war eher zufällig der Nachweis gelungen, dass eingeatmete Nanopartikel beim Menschen schwere Schäden in der Lunge auslösen und zum Tod der Patienten führen können.
Zuvor hatten Ärzte am Pekinger Chaoyang Hospital Frauen behandelt, die an Kurzatmigkeit, Rippenfellergüssen und Herzbeutelergüssen litten. Doch die zwischen Januar 2007 und April 2008 eingelieferten Patientinnen waren jung und ansonsten kerngesund. Weder hatten sie jemals geraucht, noch kamen andere Risikofaktoren als Ursachen für die Erkrankungen in Frage.
Die sieben Frauen hatten jedoch vor der Einweisung in die chinesische Eliteklinik eine wahre Odyssee durchlaufen: Von Antibiotika bis zu Wirkstoffen gegen Tuberkulose hatten Ärzte an anderen Krankenhäusern versucht, die kuriose Malaise zu kurieren - vergeblich.
Der Vorstoß der Erkrankungen an Rippenfellergüssen Ausflusses nahm derart zu, dass die Mediziner die nationale Seuchenbehörde einschalteten - und anhand einer exakten Durchleuchtung der Lebensumstände der Frauen am Ende fündig wurden.
Winzige Polyacrylat-Nanopartikel, die die Frauen an ihrer gemeinsamen Arbeitsstelle inhaliert hatten, lösten nach Ansicht der Ärzte den GAU im Körper der Patientinnen aus. Trotz aller Bemühungen der chinesischen Mediziner überlebten zwei Frauen die Attacke der Nanopartikel nicht. Ihr Tod, so viel scheint bereits jetzt festzustehen, löste eine globale Wende bei der Risikobewertung der Nanotechnologie aus.
Denn nie zuvor war es Wissenschaftlern gelungen, beim Menschen den kausalen Zusammenhang zwischen inhalierten Nanopartikeln und ihren toxischen Nebenwirkungen nachzuweisen. Zwar attestieren Tierversuche seit Jahren, dass die atomaren Winzlinge mitunter Nieren und Leber, ebenso wie die Lunge angreifen können. Schädigende Wirkungen bei exponierten Menschen indes waren bis dato zwar vermutet, aber nicht klinisch belegt worden.
Nahezu unerforscht ist die Aufnahme von Nanopartikeln im Dick- und Dünndarm. Als gesichert gilt jedoch die Annahme, wonach Nanopartikel im Körper selbst die Blut-Hirn-Schranke überwinden können.
Auf diese Weise gelangen höchst toxische Substanzen an Stellen unseres Organismus, wo ihre „normalen" Pendants niemals hinkommen würden. Doch diese toxischen Risiken und Nebenwirkungen sind noch nicht das Schlimmste, was uns die Food-Mafia zumutet. Es geht noch schlimmer: Der Trillionen-Dollar-Markt der Nanopartikel im Lebensmittelbereich lässt Menschen womöglich schneller altern.
Das jedenfalls lassen Versuche erahnen, die Forscherinnen des Leibniz Instituts für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf durchgeführt haben. Sie verfolgten markierte Silizium-Nanopartikel bis in einzelne Zellen des Fadenwurms Caenorhabditis elegans und stellten dabei eine vorzeitige Alterung der Tiere fest.
Die Biologin Anna von Mikecz mischte den Würmern Fluoreszenz-markierte Nanopartikel unter das Futter und verfolgte den Weg der Teilchen in den lebenden Fadenwürmern. Die Siliziumdioxid-Partikel gelangten bis in einzelne Zellen des Darmepithels der Fadenwürmer, danach verteilten sie sich im Zytoplasma und im Zellkern, „wo sie amyloide Proteinverklumpungen auslösten", wie die Forscherinnen berichteten. Diese Proteinklumpen treten jedoch sonst „typischerweise in alten Würmern" auf, so dass Mikecz und ihr Team wissen wollten, ob die mit Nanofood gefütterten Würmer „auch andere Anzeichen für frühzeitige Alterung aufwiesen".
Dazu beobachteten sie die Nahrungsaufnahme, die sich bei alternden Fadenwürmern im Laufe der Lebenszeit stetig verlangsamt. Tatsächlich konnte gezeigt werden, dass sich Nanopartikel aus Siliziumdioxid nicht nur in dem Organ für die Nahrungsaufnahme anreichern, sondern dass dieses Organ dann genau wie bei alten Würmern die Nahrung langsamer in den Darm pumpt.
Damit lösen die Nanopartikel vorzeitig ein Verhalten aus, das normalerweise bei alten Fadenwürmern beobachtet wird. Eine derartige vorgezogene Alterung zeigte sich auch in den Fortpflanzungsorganen und beim Fortpflanzungsverhalten der Würmer. Die Forscher vermuten, dass vor allem neuromuskuläre Vorgänge betroffen sein könnten.
„Da der Fadenwurm C. elegans ein einfaches Nervensystem aus 302 Zellen besitzt, das in seinen Grundzügen dem des Menschen stark ähnelt, ist es aussichtsreich, hier die molekularen Ursachen der Wirkung von Nanopartikeln weiter aufzuklären", teilte das Institut im Januar 2014 mit. Man könnte es direkter formulieren: Als Nanopartikel lässt E 551 die Tiere schneller altern.
Obwohl solche Erkenntnisse schon vor Jahren diskutiert wurden, passierte zum Schutz der Verbraucher bisher vor allem eins: nichts. Wer Nanolebensmittel und -produkte verkaufen will, kann das ungehindert tun. Kritik seitens der Politik? Wirksame Gesetze zum Schutz der Verbraucher? Fehlanzeige.
Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem Buch "FOOD MAFIA. Wehren Sie sich gegen die skrupellosen Methoden der Lebensmittelindustrie".
![2014-08-27-buchcover.jpg]()
ISBN: 978-3593501222
Tatsächlich ist die kalorienfreie Schokolade mit vollem Schoki-Geschmack nur eine Kreation der Nanofood-Branche. Weltweit mehr als 600 Lebensmittel zählen mittlerweile zum Repertoire einer Industrie, für die es weder gesetzliche Bestimmungen, noch Kontrollmöglichkeiten gibt - und die für den Menschen teils lebensbedrohliche Risiken birgt. Hinzu kommen bis zu 500 Lebensmittelverpackungen, die aus Nanobeschichtungen und -materialien bestehen.
Tatsächlich kommen die Substanzen in immer mehr Bereichen der Lebensmittelbranche vor - auch dort, wo wir sie gar nicht erwarten. So sollen sie in Erfrischungsgetränken, Chips oder Schokolade den Vitamingehalt erhöhen - ein beliebter Trick, um den Konsumenten den vermeintlich gesundheitsfördernden Nutzen der Produkte zu suggerieren.
In Gemüsebrühe, Kochsalz, Gewürzmischungen und Puderzucker wird Nano-Siliziumdioxid als Rieselhilfe eingesetzt. Selbst in Fleisch und Backwaren fanden Wissenschaftler Nanopartikel - in Form von Kapseln mit Vitamin A und E oder Omega-3-Fettsäuren.
Die Winzlinge erweisen sich als nahezu unerschöpfliches Reservoire - und als ultimative Gelddruckmaschine zudem.
Dabei sind die Risiken enorm - eine wirksame Deklarationpflicht gibt es nicht.
Forscher am Universitätshospital Zürich haben mit Wissenschaftlern der Schweizer Anstalt für Materialforschung (EMPA) bereits im Jahr 2010 nachgewiesen, dass Nanopartikel die Plazenta des Menschen durchdringen und auf diese Weise die Ungeborenen erreichen.
Auf kritische Berichte über die gesundheitsschädigende Wirkung von Nanopartikeln reagierten Lebensmittelhersteller noch vor wenigen Jahren harsch: Selbst große öffentlich-rechtliche Sender, die auf Nanofood aufmerksam machten, sahen sich mit Klagedrohungen konfrontiert. Doch seit der viel beachteten Schweizer Studie dürften die Drohgebärden der Vergangenheit angehören.
Die Studie belegt: Der Transport von Nanoteilchen im menschlichen Körper erfolgt nahezu ungebremst, und macht auch vor der Plazenta der werdenden Mutter nicht halt. Die im Fachblatt Environmental Health Perspectives veröffentlichte Studie zeigte damit in aller Deutlichkeit, wie sehr ungeborenes Leben durch die Nanotechnologie bedroht werden kann: Die Partikel dringen ungehindert in den Blutkreislauf der Ungeborenen.
Frauenärzte müssen womöglich umdenken und Patientinnen auf Nanoteilchen in Lebensmitteln aufmerksam machen. Den Druck der Lebensmittelindustrie brauchen Ärzte dabei kaum zu fürchten, im Gegenteil. Die rein medizinische Herangehensweise an die Nanofood-Problematik dürfte die Hersteller ohne Gesichtsverlust zum Umdenken bewegen. Denn einen massiven medizinischen Vorwurf kann die Lebensmittelindustrie nach wie vor nicht ausräumen: Klinische Studien nach den hohen Standards der Arzneimittelzulassungen (Phase I - III) gibt es für Nanoprodukte nicht.
Krebsrisiko: Nanomaterialien außer Kontrolle
Weil es keine klinischen Studien nach dem Muster der Pharmaindustrie gibt, weisen Nanofood-Hersteller immer wieder auf Laborversuche hin, die eine Unbedenklichkeit ihrer Produkte belegen sollen. Doch solche Daten, die lediglich im „Reagenzglas" gewonnen werden, sind praktisch wertlos. Denn sichere Aussagen über die krebserzeugende Wirkung von Nanomaterialien beim Menschen lassen sich anhand von Reagenzglasversuchen nicht treffen.
Zu diesem Ergebnis kam der Forschungsbericht „Bedeutung von In-vitro-Methoden zur Beurteilung der chronischen Toxizität und Karzinogenität von Nanomaterialien, Feinstäuben und Fasern", den die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) im Jahr 2011 veröffentlichte.
Bittere Erkenntnis des Berichts war die Tatsache, dass „sich über alle Studien und Stäube hinweg keine klare Korrelation zwischen der Wahrscheinlichkeit positiver Befunde der In-vitro-Versuche und den Befunden aus Langzeit-Tierversuchen und epidemiologischen Befunden finden lässt". Vereinfacht ausgedrückt: Laborergebnisse können keine Entwarnung geben, wenn man Aussagen zur Toxizität von Nanomaterialien machen will.
Tatsächlich hatte die Auswertung von 179 Datensätzen „eher einen statistischen Zusammenhang mit der Art des Auftraggebers oder Labors (öffentlich oder privat) als mit chemisch-physikalischen Partikeleigenschaften" gezeigt, wie die Bundesanstalt mitteilte. Der Autor des Berichtes plädierte sogar dafür, „dass es angesichts der Datenlage und der Schwere einer Krebserkrankung verantwortungsbewusst sei, die vorliegenden Effektbefunde bei Ratten und bei historischen Expositionen in der Epidemiologie zum Maßstab des Handelns auch bei niedrigeren Expositionshöhen zu machen". Womit er sagte: Selbst Grenzwerte bieten keine Sicherheit.
Nur einige Jahre zuvor hatten Ärzte aus China belegt, was hierzulande zunächst so gut wie niemand registrierte. Pekinger Medizinern war eher zufällig der Nachweis gelungen, dass eingeatmete Nanopartikel beim Menschen schwere Schäden in der Lunge auslösen und zum Tod der Patienten führen können.
Zuvor hatten Ärzte am Pekinger Chaoyang Hospital Frauen behandelt, die an Kurzatmigkeit, Rippenfellergüssen und Herzbeutelergüssen litten. Doch die zwischen Januar 2007 und April 2008 eingelieferten Patientinnen waren jung und ansonsten kerngesund. Weder hatten sie jemals geraucht, noch kamen andere Risikofaktoren als Ursachen für die Erkrankungen in Frage.
Die sieben Frauen hatten jedoch vor der Einweisung in die chinesische Eliteklinik eine wahre Odyssee durchlaufen: Von Antibiotika bis zu Wirkstoffen gegen Tuberkulose hatten Ärzte an anderen Krankenhäusern versucht, die kuriose Malaise zu kurieren - vergeblich.
Der Vorstoß der Erkrankungen an Rippenfellergüssen Ausflusses nahm derart zu, dass die Mediziner die nationale Seuchenbehörde einschalteten - und anhand einer exakten Durchleuchtung der Lebensumstände der Frauen am Ende fündig wurden.
Winzige Polyacrylat-Nanopartikel, die die Frauen an ihrer gemeinsamen Arbeitsstelle inhaliert hatten, lösten nach Ansicht der Ärzte den GAU im Körper der Patientinnen aus. Trotz aller Bemühungen der chinesischen Mediziner überlebten zwei Frauen die Attacke der Nanopartikel nicht. Ihr Tod, so viel scheint bereits jetzt festzustehen, löste eine globale Wende bei der Risikobewertung der Nanotechnologie aus.
Denn nie zuvor war es Wissenschaftlern gelungen, beim Menschen den kausalen Zusammenhang zwischen inhalierten Nanopartikeln und ihren toxischen Nebenwirkungen nachzuweisen. Zwar attestieren Tierversuche seit Jahren, dass die atomaren Winzlinge mitunter Nieren und Leber, ebenso wie die Lunge angreifen können. Schädigende Wirkungen bei exponierten Menschen indes waren bis dato zwar vermutet, aber nicht klinisch belegt worden.
Nahezu unerforscht ist die Aufnahme von Nanopartikeln im Dick- und Dünndarm. Als gesichert gilt jedoch die Annahme, wonach Nanopartikel im Körper selbst die Blut-Hirn-Schranke überwinden können.
Auf diese Weise gelangen höchst toxische Substanzen an Stellen unseres Organismus, wo ihre „normalen" Pendants niemals hinkommen würden. Doch diese toxischen Risiken und Nebenwirkungen sind noch nicht das Schlimmste, was uns die Food-Mafia zumutet. Es geht noch schlimmer: Der Trillionen-Dollar-Markt der Nanopartikel im Lebensmittelbereich lässt Menschen womöglich schneller altern.
Das jedenfalls lassen Versuche erahnen, die Forscherinnen des Leibniz Instituts für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf durchgeführt haben. Sie verfolgten markierte Silizium-Nanopartikel bis in einzelne Zellen des Fadenwurms Caenorhabditis elegans und stellten dabei eine vorzeitige Alterung der Tiere fest.
Die Biologin Anna von Mikecz mischte den Würmern Fluoreszenz-markierte Nanopartikel unter das Futter und verfolgte den Weg der Teilchen in den lebenden Fadenwürmern. Die Siliziumdioxid-Partikel gelangten bis in einzelne Zellen des Darmepithels der Fadenwürmer, danach verteilten sie sich im Zytoplasma und im Zellkern, „wo sie amyloide Proteinverklumpungen auslösten", wie die Forscherinnen berichteten. Diese Proteinklumpen treten jedoch sonst „typischerweise in alten Würmern" auf, so dass Mikecz und ihr Team wissen wollten, ob die mit Nanofood gefütterten Würmer „auch andere Anzeichen für frühzeitige Alterung aufwiesen".
Dazu beobachteten sie die Nahrungsaufnahme, die sich bei alternden Fadenwürmern im Laufe der Lebenszeit stetig verlangsamt. Tatsächlich konnte gezeigt werden, dass sich Nanopartikel aus Siliziumdioxid nicht nur in dem Organ für die Nahrungsaufnahme anreichern, sondern dass dieses Organ dann genau wie bei alten Würmern die Nahrung langsamer in den Darm pumpt.
Damit lösen die Nanopartikel vorzeitig ein Verhalten aus, das normalerweise bei alten Fadenwürmern beobachtet wird. Eine derartige vorgezogene Alterung zeigte sich auch in den Fortpflanzungsorganen und beim Fortpflanzungsverhalten der Würmer. Die Forscher vermuten, dass vor allem neuromuskuläre Vorgänge betroffen sein könnten.
„Da der Fadenwurm C. elegans ein einfaches Nervensystem aus 302 Zellen besitzt, das in seinen Grundzügen dem des Menschen stark ähnelt, ist es aussichtsreich, hier die molekularen Ursachen der Wirkung von Nanopartikeln weiter aufzuklären", teilte das Institut im Januar 2014 mit. Man könnte es direkter formulieren: Als Nanopartikel lässt E 551 die Tiere schneller altern.
Obwohl solche Erkenntnisse schon vor Jahren diskutiert wurden, passierte zum Schutz der Verbraucher bisher vor allem eins: nichts. Wer Nanolebensmittel und -produkte verkaufen will, kann das ungehindert tun. Kritik seitens der Politik? Wirksame Gesetze zum Schutz der Verbraucher? Fehlanzeige.
Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem Buch "FOOD MAFIA. Wehren Sie sich gegen die skrupellosen Methoden der Lebensmittelindustrie".
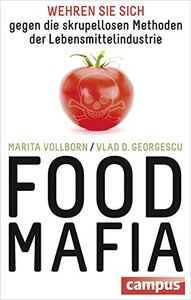
ISBN: 978-3593501222